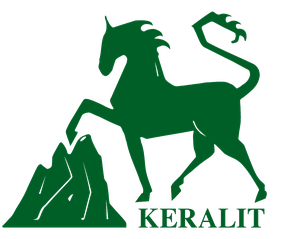Viele Pferdebesitzer von beschlagenen Pferden wünschen sich ihr Pferd von Eisen auf Barhuf umzustellen. Vorher ist es aber von großer Bedeutung, sich über die Vor- und Nachteile des Barhuflaufens und über die Dauer der Umstellung bewusst zu sein.
Es müssen individuelle Faktoren, wie Hufstellung, Hufform, Hornqualität sowie Untergrund, Geläuf und Nutzung des Pferdes mit in die Entscheidung einbezogen werden. Nicht immer bringt jedes Pferd die Voraussetzungen zum Barhufer mit. Hier sollte genau abgewägt werden, um auch dem Pferd eine optimale Lösung zu bieten.
In diesem Ratgeber erfahren Sie alles über Vor- und Nachteile, über den Ablauf sowie über die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umstellung.

Warum ein Pferd auf Barhuf umstellen?
Für die Umstellung auf Barhuf sprechen verschiedene Gründe und Faktoren.
Lange nicht alle Pferde müssen unbedingt beschlagen werden, sehr viele Pferde, insbesondere im Freizeitbereich kommen problemlos ohne Beschlag oder einen anderen Hufschutz aus. Auch im Sport gibt es mittlerweile hocherfolgreiche Barhuf-Pferde, die ohne Eisen bestens auskommen.
Auch wenn ein Pferd in Rente geht, in die Zucht kommt oder eine längere Weidepause bekommt, bietet sich ein Wechsel zum Barhufer an – vorausgesetzt, das Pferd kommt nicht auf allzu steinigen Boden. Die Hufe sind dann keiner großen Abnutzung ausgesetzt und die Verletzungsgefahr für das Pferd selbst sowie die Koppelgenossen wird deutlich verringert. Auch Schnee kann ohne Beschläge kaum aufstollen.
Ein erfreulicher Nebeneffekt ohne Beschlag: Bei einem Barhuf-Pferd fallen deutlich geringere Kosten für die regelmäßige Hufbearbeitung an.
Der Hufmechanismus
Ein weiterer Grund für eine Umstellung ist der Wunsch nach der Erlangung eines natürlichen, meist stärker ausgeprägten Hufmechanismus und damit einer besseren Durchblutung der Hufe und natürlich der ganzen Gliedmaßen selbst.

Beschlagen oder Barhuf?
Einfluss auf Stellung und Bewegungsablauf
Mit einem Beschlag ist der Hufbearbeiter in der Lage, die seitliche und vertikale Stellung der Hufe und auch der ganzen Gliedmaße zu beeinflussen. Fehlstellungen sind oft mit einem Beschlag besser zu korrigieren, bzw. in Ihrer Form zu erhalten.
Barhufig verstärken sich manche Stellungsfehler durch die vermehrt einseitige Abnutzung, z.B. extrem zehenenge oder zehenweite Stellungen oder auch sehr steile, bockhufige oder sehr flache Hufe. Hier hat man barhufig eigentlich nur vom Fohlenalter bis zum 3 bis 4 Jährigen einen bleibenden Einfluss, indem man alle 1 bis 2 Wochen korrigiert. Bei jedem Wachstumsschub kann dann eine Veränderung stattfinden. Nach dem Schließen der Epiphysenfugen geht das nur noch minimal. Das Gewicht eines Beschlages verändert Fußung und Bewegungsablauf des Pferdes. Oftmals in einer vom Schmied gewünschten Form.

Stellungskorrekturen am Barhuf
Im Gegensatz zu beschlagenen Hufen kann am Barhuf-Pferd aber auch zwischen den Bearbeitungsperioden korrigiert werden. Lassen Sie sich von Ihrem Hufbearbeiter zeigen, an welchen Hufbereichen Horn abgeraspelt werden muss, um eine Stellungsverbesserung zu erreichen.

Bessere Hornqualität durch Barhuf
Die Hornwände und die Sohle wachsen beim gesunden Barhufer stabiler, oft auch dicker als beim beschlagenen Pferd und das nicht nur wegen der fehlenden Nagellöcher, sondern weil die hornproduzierenden Lederhäute stärker zur Hornproduktion angeregt werden.
Risiko bei beschlagenen Hufen: White Line Disease
Normale Beschlagsperioden dauern je nach Hornwachstum 6 bis 10 Wochen. Solange haben dann auch hornzersetzende Keime Zeit unter dem Eisen in die Weiße Linie sowie die Nagellöcher einzudringen und das Horn zu schädigen - ein Prozess, der als White Line Disease bekannt ist. Das sieht man beim Schmied nach Eisenabnahme als eine mehlig-schwarz “Weiße Linie” vorwiegend im Seitenwandbereich und in den Eckstrebenwinkeln.
Ist genug gesundes Horn nachgewachsen, kann der Schmied das geschädigte Material beim Ausschneiden entfernen. Wenn nicht, fangen oft Probleme mit hohlen Wänden und Wandausbrüchen an. Daher ist es beim beschlagenen Pferd sinnvoll, den Keralit Huf-Festiger nicht nur auf die Wand und die Nagellöcher aufzutragen, sondern auch von der Sohlenseite her unters Eisen laufen zu lassen oder von vorneherein gleich das Keralit Undercover unter dem Eisen zu nutzen.

Zeitlicher Rahmen: Wie lange darf eine Umstellung auf Barhuf dauern?
Wichtig zu beachten:
Nicht alle Pferde können in einer kürzeren Zeit einfach so auf Barhuf umgestellt werden. Auch die Kosteneinsparung darf keinesfalls die Gesundheit und Lebensqualität des Pferdes einschränken! Darum muss auch die Dauer der Umstellung in einem für das Pferd verträglichen Rahmen bleiben. Und, falls keine Fortschritte beim Pferd sichtbar sind, eben auch eine Rückkehr zum Beschlag bzw. Hufschutz akzeptiert werden.
Eine Umstellung kann sich ohne weiteres bis zu einem halben Jahr hinziehen. In dieser Zeit ist es aber wichtig, dass man kontinuierlich eine Verbesserung von Gangbild und Hornqualität feststellt.
Ein gutes Beispiel zeigt die nachfolgende Fotoserie:

Foto 3: Isländer Drafnar: Beginn der Umstellung durch Eisenverlust, nichts geht mehr
Foto 4: 3 Wochen nach Umstellung, die Hornwanddefekte wachsen heraus

Foto 5: ca. 10 Wochen nach Beginn der Umstellung, die Wandschäden sind komplett herausgewachsen, gute, belastbare Hufe
Wichtig in dieser Zeit:
Wand und Sohle wurden in dieser Zeit alle 2-3 Tage mit dem Keralit Huf-Festiger eingepinselt, Hufbearbeiter und der Pferdebesitzer haben ständig dafür gesorgt, dass lose Hornfetzen an Wand und Sohle entfernt, sowie die Kanten am Tragrand abgerundet wurden.

Sportpferde in der Winterpause
Auch Sportpferden werden über die Wintermonate oft die Eisen abgenommen, da sie in dieser Zeit vermehrt auf weichem Boden bewegt werden. Die alten Nagellöcher können in der Winterpause dann einmal komplett herauswachsen. Gerade in dieser Phase leistet der Keralit Huf-Festiger besonders wertvolle Dienste, indem er das bestehende und auch das neu nachwachsende Horn stabilisiert und vor weiterer Schädigung schützt. Auch Weiße Linie und Hufsohle werden deutlich stabiler und druckunempfindlicher, eine Umstellung fällt dem Pferd somit deutlich leichter.
Im Winter beachten: Eine unebene gefrorene Winterkoppel oder der Auslauf (gefrorene Matschkoppel) ist wie ein Schotterauslauf mit großen Steinen und macht Barhufern schnell echte Probleme.
Barfuß, wenn gar nichts anderes mehr geht
Hornwandschäden, Wandausbrüche, Risse, hohle Wände. Auch wenn die Hornwand im Seitenwandbereich so geschädigt ist, dass der Schmied kaum noch sinnvoll haltbare Nägel einschlagen kann, wird es Zeit, über eine Barhufperiode nachzudenken.
Oftmals bleibt einem dann auch gar nichts anderes mehr übrig. Mittlerweile kann zwar mit künstlichem Horn, also einem geklebten Kunststoff mit hornähnlichen Eigenschaften, fehlendes Wandhorn ersetzt werden, in das auch genagelt werden kann. Dies ist allerdings recht kostspielig und natürlich lange nicht so gut und haltbar wie das natürlich gewachsene Horn. Auch Fäulnisprozesse können sich unter dem Kleber leicht bilden.

Die erste Zeit nach der Umstellung: Was Barhuf-Pferde jetzt brauchen
Häufige Probleme: Klammer Gang & Wandausbrüche
Das Risiko, dass die Umstellung aufgrund von Empfindlichkeit und zu hoher Abnutzung zu einem klammen Gang führt, ist anfangs recht hoch. Hier muss mit der noch vorhandenen Hornsubstanz gut ``gehaushaltet´´ werden und die Böden, auf denen geritten wird, müssen gefühlvoll ausgesucht werden.
Insbesondere in der Zeit, in der noch durch die Nagelung geschwächte Wände mit herunterwachsen, sind Wandausbrüche keine Seltenheit. Durch ein Entfernen weg hängender Hornwandstücke verhindert man ein weiteres Einreißen und größere Hornwandschäden.
Ein neues Tastgefühl erlernen
Je nach Rasse und Hufform müssen dem Pferd jetzt einige Wochen bis Monate Zeit zur Umstellung gegeben werden. Ein anfangs klammer Gang hat mehrere Ursachen: zu starker Abrieb, zu langsames Hufwachstum oder Unsicherheit des Pferdes. Denn bislang hat das Eisen die Tastfähigkeit des Hufes nahezu verhindert – diese muss nun erst neu erlernt werden.
Zum Beispiel, wenn ein Pferd auf einer schrägen Ebene läuft, oder auf eine Unebenheit tritt und sich der Huf in der Höhe dem schrägen Boden anpasst. Diese Bewegung wurde vorher vom Eisen komplett kompensiert und dann von den darüberliegenden Gelenken unter Belastung abgebaut. Dies kann vom Pferd vorerst als ungewohnt empfunden werden und ist nicht mit Fühligkeit gleichzusetzen.
In dieser ersten Zeit müssen natürlich Fehlstellungen besondere Beachtung und Korrektur durch einen Hufbearbeiter finden. Durch das Barfußlaufen geraten jetzt vom Boden Wachstumsimpulse an Sohlen-, Wand-, Strahl- und Kronlederhaut, welche für ein stabiles und zunehmend dickeres Horn sorgen. Die Zeit, bis dann das festere Horn zur Verfügung steht, ist bei jedem Pferd unterschiedlich lang.

Gerade in dieser Phase leistet der Keralit Huf-Festiger besonders wertvolle Dienste, indem er das bestehende und auch das neu nachwachsende Horn stabilisiert und vor weiterer Schädigung schützt. Auch Weiße Linie und Hufsohle werden deutlich stabiler und druckunempfindlicher, eine Umstellung fällt dem Pferd somit deutlich leichter.

Zurück zum Beschlag - Wann braucht ein Pferd doch wieder einen Hufschutz?
-
Generell bei zu hohem Abrieb von Wand und Sohle, also wenn Abrieb und Wachstum auch über längere Zeit nicht im Gleichgewicht stehen.
-
Bei erkennbar anhaltend unwillig klammen Gang, mit Fühligkeit auch noch mehrere Wochen bis Monate nach der Barhufumstellung, trotz guter Voraussetzungen.
Neben Ausbrüchen kann sich an den Hufen auch eine Erhöhung der Temperatur zeigen, da das Sohlenhorn die Sohlenlederhaut unter Umständen nicht ausreichend vor äußeren Einflüssen, wie Druck durch Steinchen schützen kann.
Extrem wichtig: Hufform und Sohlenwölbung

Bei einer höher gewölbten Sohle drückt nicht gleich jeder Stein
Alle diese Erscheinungen können bei Pferden völlig individuell stark und auch unterschiedlich lange auftreten. Hufform und Hornqualität zum Zeitpunkt der Eisenabnahme spielen hierbei natürlich eine wesentliche Rolle.
Bei Hufkrankheiten, wie z.B. Hufkrebs, hohlen Wänden oder Hornspalten sollte man mit Schmied und Tierarzt die Situation genauestens besprechen, ob das Barhuf laufen lassen sinnvoll ist. Insbesondere bei Rehepferden ist ein Barhuf Laufen durch das rotierte und/oder abgesenkte Hufbein oft fraglich. Durch ein Absinken des Hufbeines verringert sich die Sohlenwölbung und damit auch die Dicke der Sohle, was in Folge zu Schmerzen führen kann. Es gibt aber auch Rehepferde mit einer chronischen bzw. ausgeheilten Rehe, die barhufig besser laufen als mit diversen Beschlägen.
Auch rassetypisch ungünstige Voraussetzungen, wie z.B. extrem flache Hufe mit dünnen Wänden oder einer dünnen Sohle oft in Verbindung mit schlechter Hornqualität erschweren eine Umstellung oder machen sie unmöglich (oft bei Vollblütern).
Anatomisch gesehen fällt die Umstellung kräftigen, schweren Pferden mit eher breiten flachen Hufen deutlich schwerer als leichteren Pferden mit einer eher engeren Hufform, mit steileren Hufwänden und somit einer gut ausgeprägten Sohlenwölbung.
Mit ausschlaggebend für die Entscheidung zur Umstellung sind natürlich auch die Bodenverhältnisse vor Ort.

Foto 9: Extrem stark abgenutzter Huf, mit nur sehr geringer Sohlenwölbung. Das Pferd läuft fühlig und fast nur noch auf Sohle und Strahl
Video-Tipp: Ein informatives Video zum Thema Barhuf, Sohlengewölbe und Fühligkeit finden Sie hier.

Sie möchten Ihr Pferd umstellen?
In Teil 2 erfahren Sie, wie Sie die Umstellung auf Barhuf konkret angehen: Zeitpunkt wählen, Hufe vorbereiten, erste Wochen meistern und typische Probleme lösen.