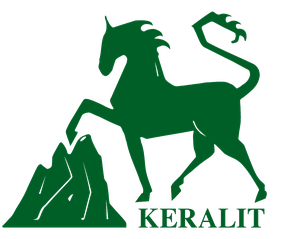Grundsätzliches zu ausbrechenden Hufen
Hufwand ausgebrochen - und nun? Ausgebrochene Hufwände sind ein ernsthaftes Problem für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Pferden. In diesem Ratgeber erfahren Sie alles über die Ursachen, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten dieses häufigen Hufproblems. Wir geben Ihnen wertvolle Tipps.
Was sind ausgebrochene Hufe?
Ausgebrochene Hufe haben Risse oder Absplitterungen im Wandhorn des Hufes. Diese Schäden können oberflächlich sein oder tief ins Wandhorn eindringen und sowohl beschlagene als auch barhufige Pferde betreffen. Ausgebrochene Hufwände beeinträchtigen die Funktion, Statik und Stabilität des Hufes und können im fortgeschrittenen Stadium auch zu Schmerzen und Lahmheit führen.
Ausbrechende Hufwände, egal ob beschlagen oder barhufig, haben immer eine oder mehrere Ursachen. Im Folgenden erklären wir Ihnen, wie diese Hornschäden zu Stande kommen, wie man sie vermeiden oder wenn es schon zu spät ist, effektiv behandeln kann.

Abb. 1: Starke Wandausbrüche im Bereich der Nagelung
Warum brechen Hufe aus?
Ursprünglich ist das Pferd ein Steppentier und daher aufgrund der Evolution eher für sandiges, trockenes Geläuf gemacht. In unseren Breitengraden kommen die Hufe der Pferde oft über längere Zeit mit sehr viel Wasser (nasse Ausläufe, Koppeln, häufiges Abwaschen) und bei Stallhaltung, auch bei guter Stallhygiene, mit einem schädigenden Urin-Kot-Ammoniak-Gemisch in Kontakt.
Diese ständige Feuchte führt auf Dauer zu Fäulnisprozessen des Horns. Insbesondere bei beschlagenen Pferden, da die Nässe oft sehr lange unter dem Eisen bleibt. Bei Barhufern kann sich jedoch ebenfalls eine vertiefte Weiße Linie bilden. Betroffen ist vorwiegend das Strahlhorn und das Horn der Weißen Linie. Beide Bereiche bestehen aus Weichhorn und sind für Fäulnisprozesse viel anfälliger als das festere Harthorn von Wand und Sohle.
Das bedeutet, dass die Fäulnis verursachenden Keime (Pilze und Bakterien) als Erstes in diesen Bereichen zu Schäden führen, bekannt als Strahlfäule und White Line Disease, kurz WLD, die Erkrankung der Weißen Linie. Diese Fäulnisprozesse können sich auch über längere Trockenperioden aufrechterhalten, da bei der Hornzersetzung Schadstoffe entstehen, die wiederum Horn auflösen können. Dazu zählt z.B. der Schwefelwasserstoff mit dem typischen faul-Ei Geruch bei der Strahlfäule. Dies ist eine Art Teufelskreis, den es zu durchbrechen gilt.
Lose Eisen, ausgebrochene Nägel
Bei den beschlagenen Pferden ist der Bereich des Tragrandes und die Weiße Linie über die gesamte Beschlagsperiode vom Eisen abgedeckt und kann nur beim Umbeschlagen vom Schmied behandelt werden. Das bedeutet, die schädigenden Keime haben während der Beschlagsperiode 6 bis 8 Wochen ungestört Zeit das Horn der Weißen Linie zu zersetzen und das in einem, für die Keime, optimalen Milieu. Die Abdeckung durch das Hufeisen bietet Feuchtigkeit, Dunkelheit und Luftabschluss. Darüber hinaus liefert der Huf Wärme und die Stalleinstreu einen alkalischen pH-Wert. Somit werden ideale Lebensbedingungen für die Keime geschaffen.
Mehrere Generationen Nagellöcher
Beim beschlagenen Pferd entstehen so Schäden in der Weißen Linie, bis nach oben über den Nagelbereich. Begünstigt wird dies durch die Schwächung der Wand durch die alten und neuen Nagellöcher.
Ausbrechende Nägel und lose oder verlorene Eisen, an welchen dann größere Teile der Hufwand hängen sind die Folge. Selbst ein guter Schmied hat hier kaum noch die Möglichkeit, sinnvoll haltbare Nägel einzuschlagen. Beim erneuten Aufnageln reißen die Nägel in die alten Nagellöcher ein. Diese Nägel sind nicht mehr belastbar. Ist ein Eisen bereits gelockert, wird die Wand immer instabiler.
Ist kein sinnvolles Nageln mehr möglich, ist ein Klebeschuh oder die Umstellung auf barhuf angesagt.
Aber auch die Hufnägel selbst können ein Ausbrechen der Hufwände beschleunigen. Der Schmied muss das Eisen immer so Richten - also Formen -, dass die Nägel beim Einschlagen zuerst ins Weichhorn der Weißen Linie eindringen und erst nach einigen Zentimetern in die härtere Hufwand. Wird der Nagel zu früh oder gleich in die härtere Hufwand getrieben, hat er dort einen starken Spreizeffekt. Dieser kann dann zu einer Rissbildung führen. Eine sehr niedrige Nagelung kann ebenfalls zu Rissen führen. Bei korrekt gesetzten Nägeln kann die Elastizität des Hornes den Spreizeffekt abfangen. Manchmal lässt sich jedoch aufgrund der Hufform, extremer Fühligkeit oder bei div. Hornschäden ein optimales Setzen der Nägel nicht ideal verwirklichen.

Abb. 2: So ein Eisen hält nicht lange
Lose Eisen abnehmen
Jede neue Generation Nagellöcher schwächt die Hufwand. Grundsätzlich ist das kein Problem. Bei einem gesunden Huf wächst immer so viel Horn nach, dass beim Umbeschlagen vom Schmied in neues, tragfähiges Horn genagelt werden kann.
Müssen während der Beschlagsperiode, wegen loser oder verlorener Eisen, zusätzlich noch neue Nägel gesetzt werden, verliert die Wand schnell an Stabilität. Lockere Eisen, auch wenn sie nur geringgradig wackeln, zerstören sehr viel Horn, weil die Nägel durch das Rutschen des Hufes auf dem Eisen querbelastet werden. Das bedeutet, dass die Nagellöcher sich seitlich stark ausweiten und so zu weiteren Rissen und Ausbrüchen führen. Ein loses Eisen gehört also zur Vermeidung weiterer Hornschäden schnellstmöglich wieder korrekt aufgenagelt oder abgenommen.
Auch Barhufer sind betroffen
Beim Barhufer gibt es natürlich keine Probleme mit der Nagelung. Hier haben eher die Hufform, mechanische Werte und das Geläuf Einfluss auf die Hufstabilität. Die Vorgänge bei der Hornzersetzung durch Keime und Schadstoffe finden aber genauso statt.

Liegt der Fehler in der Pflege?
Sehr häufig werden solche Schäden als „zu trockene Hufe“ interpretiert, es wird einem geraten viel zu Wässern und danach zu Fetten. Leider ist dieses Vorgehen jedoch kontraproduktiv, denn das Wässern begünstigt die Fäulnisprozesse extrem.
Grundsätzlich sollte man derart geschädigte Hufe eher trocken halten, da die verursachenden Keime die Feuchtigkeit lieben. Zur Behandlung sollte man keinerlei Fette oder Öle anwenden, diese schließen die Keime ein. Zum Säubern sollte man keine Seifen verwenden, auch keine Kernseife. Seifen sind alkalisch und fördern die Hornzersetzung.
Hier sollte ausschließlich der Keralit Huf-Festiger angewendet werden. Bei größeren Ausbrüchen sollte der Huf-Festiger alle ein bis zwei Tage angewendet werden, in weniger schlimmen Fällen genügt die Anwendung ein bis zwei Mal pro Woche. Wichtig ist, den Huf-Festiger auf den weitgehend trockenen Huf aufzutragen, damit das Horn den Huf-Festiger auch gut aufnehmen kann. Wenn die Hufe vorher gewaschen werden, saugen sie sich mit Wasser voll und nehmen somit weniger vom Huf-Festiger auf. Zur vorherigen Reinigung sollte das Horn also nur mit harter Bürste trocken abgebürstet werden.

Abb. 4: Durch konsequente Pflege mit dem Huffestiger gut herabgewachsener Hornwandschaden
Ihr Hufbearbeiter sollte bei jedem Termin das defekte Horn, welches nur noch lose am Huf hängt und keinerlei Tragfähigkeit hat, soweit möglich entfernen. So können die darunter liegenden, geschädigten Bereiche effektiver erreicht werden.
Ursachen ausbrechender Hufe zusammengefasst
Hufe brechen durch eine Vielzahl an Faktoren aus:
- Feuchtigkeit: In unseren Breitengraden kommen die Hufe der Pferde oft über längere Zeit mit Wasser in Kontakt, z. B. durch nasse Ausläufe, Koppeln und häufiges Abwaschen. Diese ständige Feuchte führt auf Dauer zu Fäulnisprozessen am Horn, insbesondere bei beschlagenen Pferden, da die Nässe lange unter dem Eisen bleibt.
- Fäulnisprozesse: Die Feuchtigkeit begünstigt die Fäulnisprozesse durch Bakterien und Pilze, die das Weichhorn der Weißen Linie und des Strahls angreifen.
- Beschlag: Bei beschlagenen Pferden ist der Tragrand und die weiße Linie über die gesamte Beschlagsperiode vom Eisen abgedeckt, was die Ansammlung von Feuchtigkeit und schädlichen Keimen begünstigt. Alte und neue Nagellöcher schwächen die Hufwand zusätzlich.
Einen Hufwandbruch diagnostizieren
Die Diagnose eines Hufwandbruchs erfolgt meist durch Sichtprüfung des Hufes. Typische Symptome sind sichtbare Risse oder Absplitterungen der Hufwand, oft reichen die Schäden in der Weißen Linie aber deutlich höher als auf Anhieb erkennbar ist. Ein erfahrener Hufschmied oder Tierarzt kann den Schweregrad des Hufwandbruchs genauer untersuchen und entsprechende Maßnahmen zur Behandlung empfehlen.