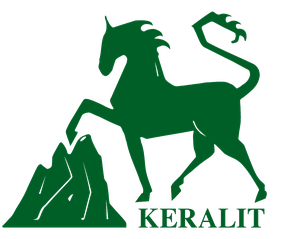Es gibt mehrere Formen der Huflederhautentzündung, grob eingeteilt spricht man von einer septischen und einer aseptischen Form. Die unterschiedlichen Formen entstehen durch verschiedene Ursachen. Jedoch können auch in Verbindung mit einer akuten Hufrehe oder einer chronischen Hufrehe gleichartige Symptome auftreten.
Septische Huflederhautentzündung
Die septische Form entsteht, wenn Keime in den Huf gelangen. Sie breiten sich im Bereich der Weißen Linie und der Sohle aus, nachdem diese verletzt wurden. Dies kann durch Fremdkörper wie Nägel oder spitze Steine sowie in Folge von Hufabszessen geschehen. Behandlung, Krankheitsverlauf und Prognose sind daher ähnlich wie bei Hufabszessen.

Abb. 1: Septische Huflederhautentzündung, bereits in der Abheilung
Septische Huflederhautentzündung behandeln
In der akuten Phase ist diese Form der Huflederhautentzündung definitiv Tierarztangelegenheit, ähnlich wie beim Hufabszess. Der Veterinär entscheidet ob und wie weit der Entzündungsherd für eine Drainagemöglichkeit geöffnet werden muss und über die Erforderlichkeit einer Antibiotikagabe. Anschließend sollte der Sohlenbereich in der Abheilungsphase gut geschützt sein. Eine Möglichkeit: Der Schmied fertigt ein sogenanntes Deckeleisen, bei welchem der Wundbereich gut erreichbar ist und die Wunde behandelt und dann durch einfaches Aufschrauben einer Metallplatte wieder geschützt werden kann. Solche Systeme gibt es in verschiedenen Varianten bereits vorgefertigt.

Ähnliche Systeme kann man auch mit Klebe- oder Kunststoffbeschlägen erreichen. Wichtig ist hier die Verwendung von Beschlägen mit steifem Metallkern, da zumindest in der Anfangsphase jede Verformung des Hufes - auch die des normalen Hufmechanismus – dem Pferd Schmerzen bereitet.
Ein Hufschuh ist grundsätzlich auch eine Möglichkeit. Zu beachten ist aber, dass viele Hufschuhe die Befestigung über Fessel und Ballen mittels Klemmung durch Bänder oder Schnallen erreichen. Somit sind sie für eine dauerhafte Fixierung bei Boxenruhe nicht geeignet.
Aseptische Huflederhautentzündung
Bei der aseptischen Form ist immer eine Reizung der Huflederhaut die Ursache – egal ob beschlagen oder barhuf. Diese kann auch durch den Hufbeschlag verursacht werden. Eine aseptische Huflederhautentzündung kann beim Barhufer durch zu kurz abgelaufene Hufe entstehen. Sohlenlederhautentzündungen kommen jedoch auch beim beschlagenen Pferd vor. Dies wird verursacht, wenn der Hufbearbeiter etwas zu viel von Wand und Sohle kürzt oder zu lange aufbrennt. Die Empfindlichkeit der Pferde ist dabei extrem unterschiedlich. Hier ist Schonung angesagt, das Pferd sollte maximal auf weichem Boden bewegt werden.


Besonderheiten bei barhufigen Pferden
Barhufer benötigen eine feste und stabile Hufsohle, da das gesamte Körpergewicht sowie das Reitergewicht auf den Hufen lastet. Nach einem Sprung können dies bei der Landung bis zu 3000 kg auf einem Huf sein.
Die Huflederhaut entzündet sich meist nicht durch das Landen auf einem spitzen Stein. Sie wird eher durch eine lang anhaltende Reizung auf steinigem oder hartem Boden verursacht. Das kann sowohl im Gelände als auch auf der Koppel passieren.
Weitere begünstigende Faktoren sind längere Trockenheit oder Frost. Diese Wetterbedingungen verhärten die Böden von Koppeln und Paddocks. Dies kann schnell zu Huflederhautentzündungen führen.


Abb. 4: Stark abgelaufene Hornwand. Das Pferd läuft nur noch auf der Sohle
Die Pferde laufen dann zunehmend klamm. Pferde mit flachen Hufen und wenig Sohlenwölbung sind hier besonders empfindlich. Jeder Stein kann in so einem Fall drücken. Bei einem Huf mit höherem Sohlengewölbe kommt die Sohle deutlich weniger mit dem Boden in Berührung.
Sehr schlecht für Barhufer sind befestigte Wege mit Kies oder gar Schotter. Hier gibt nicht der Boden nach, sondern nur der Huf, z.B. Teerwege mit Steinchen darauf. Das kann auch zu größeren Wandausbrüchen führen. Mit einem Barhufer sollten diese Wege daher grundsätzlich gemieden werden. Wichtig ist deshalb ein eher nachgebender Untergrund.
Beim Barhufer ist das gesunde Gleichgewicht zwischen Abrieb und nachwachsendem Horn an Tragrand und Sohle entscheidend. Besteht hier ein Ungleichgewicht, bei dem mehr Horn abgerieben wird als nachwächst, führt dies unweigerlich zu einer zu dünnen Sohle.
Abrieb an Wand und Sohle vermindern
Abhilfe schafft der Einsatz des Keralit Huf-Festigers, der das Horn von Wand, Weißer Linie und Sohle stabilisiert und so vor Ausbrüchen und erhöhtem Abrieb schützt. Dank des Keralit Huf-Festigers können zahlreiche Pferde problemlos ohne Hufeisen auskommen. Auch die Umstellung zum Barhufer fällt wesentlich leichter.